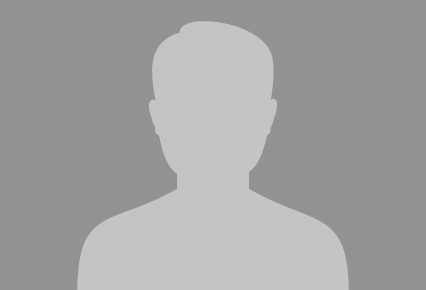Können die Methoden, mit denen in der Vergangenheit Elitekräfte ausgebildet wurden, auch heute noch Spitzenkämpfer hervorbringen?
In this blog post:
Soeren Suenkler, Chefredakteur von K-ISOM und Veteran globaler SOF-Operationen, untersucht, wie westliche Spezialeinheiten ihr Vorgehen bei der Auswahl, Ausbildung und Entwicklung von Elite-Einsatzkräften überdenken. Von kognitiven Einschätzungen über Virtual-Reality-Simulationen bis hin zu Human Performance Labs konzentrieren sich heutige Programme nicht nur auf Ausdauer und Zähigkeit, sondern auch darauf, das volle Potenzial jedes Kandidaten für eine lange, leistungsstarke Karriere freizusetzen.
Autor: Soeren Suenkler
Das Auswahlverfahren und die Ausbildung für westliche Special Operations Forces (SOF) der NATO und dessen Verbündete war über viele Jahrzehnte unverändert. Sicherlich gab es im Rahmen der Ausbildung immer gelegentliche Verbesserungen und Anpassungen und moderne Ausrüstung und Einsatzverfahren. Ebenso wurden auch die Auswahlverfahren gelegentlich neu angepasst. Aber der große Clou blieb aus. Dabei hätte es schon ein Jahren einen Neuanfang für die Selektion und fortführende SOF-Ausbildung geben müssen. Dies wurde durch den Global War on Terror (GWOT) im Ausland weitgehend 20 Jahre lang verhindert. Man hatte andere Probleme. Mit der Rückbesinnung auf die NATO-Kerndoktrin hat sich für militärische westliche SOF sehr viel verändert. Ebenso umfasst die Auswahl und die Ausbildung westlicher Tier-1 und Tier-2 Polizeispezialeinheiten viel mehr Bedrohungslagen im Rahmen der Gefahrenabwehr im Bereich der Inneren Sicherheit. Terrorismus und Narco-Kartelle sind mittlerweile auch in Europa angekommen. Dazu kommen Wirtschaftskrise, schnelle gesellschaftliche Veränderungen und illegale Massenmigration. Alles umfangreiche und komplexe Themen.
Verschiebung der Realitäten
Zeitgleich hat die Technologie massive Fortschritte gemacht und auch die Psychologie bewertet Menschen und seine Handlungen anders als noch vor 20 Jahren. Auslöser sind eine massive Digitalisierung der alltäglichen Umgebung, der Verknappung der Ressourcen Zeit und Geld sowie eine immer dringender werdende Situation in Europa. Ebenso hat man erkannt, dass westliche SOF Operators, die 20 Jahre lang im Anti-Terrorkampf in Afghanistan, Irak, Afrika und Syrien standen, schwer in eine sich sehr schnell verändernde Gesellschaft zurückintegrierbar sind.
Probleme mit SOF Operators traten in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien fast zeitgleich auf. Ein Thema sind dabei soziale und gesellschaftliche Probleme sowie Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bei regelrecht „verschlissenen“ Einsatzkräften. Frühzeitige Entlassungen, hoher Krankenstand und Probleme bei Führung und Eignung sind die Konsequenz. Dabei handelt es sich nicht um Anfänger die der Situation nicht gewachsen wären, sondern um hochwertig ausgebildete und hochausgezeichnete SOF Veteranen. Eine massive Verschwendung an Humanen Ressourcen, die in kein System mehr passen. Man hat jedoch erkannt, dass dies sich ändern muss. Die Personalknappheit, ein massives Aufkommen an Aufgaben und Missionen sowie eine unbedingt nötige Prozessoptimierung zwingen die Behörden regelrecht dazu, die Rekrutierung und Ausbildung von SOF Einsatzkräften bei Polizei und Militär stark zu verändern, neu anzupassen und teilweise komplett neu zu denken. Wir begeben uns gerade in ein neues Zeitalter.
Auswahl von Spezialkräften: alte Methoden, neue Probleme
Einer der vorherigen Probleme war in der Vergangenheit, die Rekrutierung von SOF Operators bei Polizei und Militär als Selektion zu verstehen. Um so mehr man an Kandidaten aussiebte und um so körperlich härter man die Selektion vorantrieb, um so weniger Kandidaten blieben zum Schluss übrig. Diese sollten dann angeblich die Speerspitze sein. Ihnen traute man dann zu, die weitere harte Ausbildung für die stressigen Einsätze zu bestehen. Diese Methodik basierte auf den Erfahrungen der letzten 50 Jahre.
Lies unsere ausführliche Analyse in Was macht Special Forces so „special“?, um zu verstehen, was Elite-Einsatzkräfte auszeichnet.
Beispiele: Der 21 Tage dauernde Special Forces Qualification Course (SFQC) der Green Berets der US Army (Tier 2) siebt zwischen 23 % und 50 % aller Kandidaten aus, die die Ausbildung nicht weiter fortführen (durchschnittlich 35 %). Der Personalbedarf ist jedoch sehr hoch. Sieben aktive Special Forces Groups (SFG) müssen durchgehend mit Personalersatz bestückt werden. Die Durchfallquote bei der 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne) bzw.1st SFOD/CAG ist vermutlich sehr viel höher. Die US Army publiziert darüber keine Daten. Ebenso bei der United States Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU). Als Vergleich können hier andere Tier-1 SOF der NATO gelten, wie der britische Special Air Service (SAS) oder das deutsche Kommando Spezialkräfte (KSK) des Heeres der Bundeswehr. Vom KSK weiß man, dass von ca. 120 bis 150 Kandidaten zum Schluss zur noch ca. ein Dutzend übrig bleiben, die die Auswahl bestehen. Eine Selektion wird zweimal im Jahr durchgeführt (Frühling April und Herbst Oktober). Zeitweise bestand jedoch kein einziger Kandidat die Auswahl.

Durch Optimierungsprozesse konnten in den letzten Jahren die Anzahl der erfolgreichen Absolventen der Selektion auf ca. 20 erhöht werden. Im Januar 2024 schrieb die Bundeswehr jedoch, dass sich nur noch 32 Kandidaten der Phase I für das KSK gestellt hatten. Für eine Einwohnerzahl von über 83 Millionen Menschen in Deutschland, ist das beängstigend wenig. Dies kompensiert nämlich nicht die Abgänge und Ausfälle in der Spezialeinheit. Das ist ein Problem, das ähnlich auch beim britischen SAS wahrgenommen wird. Ähnlich die Situation bei der deutschen Tier-1 Polizeieinheit GSG 9 der Bundespolizei. Die Rekrutierung der Einsatzkräfte ersetzt kaum die natürlichen oder erzwungenen Abgänge. Das ist Fakt und betrifft allerdings querschnittlicht alle westlichen SOF von Polizei sowie Militär und ist kein neues Thema.
Im Rahmen der vorher angewendeten Methodik müsste man nur einfach die Anzahl der SOF-Kandidaten erhöhen. Von 200 würden es dann 20 schaffen. Von 500 dann 50 usw. Diese Logik funktioniert jedoch nicht. Ein Grund für dieses Problem ist der real existierendeDemographische Wandel. Es gibt immer weniger junge Menschen, die die benötigte passende Staatsbürgerschaft im Land besitzen, gesund sowie fit sind und sich für einen Dienst in den Streitkräften oder der Polizei interessieren. Das ist Fakt. Ebenso gibt es einen sehr stark konkurrierenden zivilen Arbeitsmarkt, der viel Potential von der Schulbank regelrecht wegrekrutiert. Fazit: Das Potential für SOF wird nicht mehr, sondern immer weniger bei gleichzeitig wachsenden Aufgaben.

Eine Reaktivierung der Wehrpflicht um den Pool der möglichen Kandidaten zwangsweise zu erhöhen steht in fast allen westlichen Ländern politisch zwar zur Diskussion, wird aber vermutlich das Problem auch nicht lösen.
MELDE DICH FÜR WEITERE INFOS WIE DIESE AN
Trage deine E-Mail-Adresse ein und bleibe auf dem Laufenden über Taktische Bekleidung und andere relevante Themen.
Du meldest Dich für unseren Newsletter an und Du kannst Dich jederzeit abmelden. Lese mehr in unserer Datenschutzerklärung.
Transformation der Auswahl und Ausbildung von SOFs für das 21. Jahrhundert
Vielmehr geht es nun darum, das knappe Potential besser und prozessoptimierter sowie flexibler zu nutzen. SOF Operators müssen heute viel länger im Dienst bleiben (40+), mehr leisten und viel flexibler agieren. Die US Army hat dazu das Konzept des SOCOM Warrior Athlete ausgebaut, das auf dem Objective Force Warrior und dem früheren Future Force Warrior der Infanterie basiert. Neu ist das US Cognitive Warrior Project Konzept, das auf vielen Ebenen heiß diskutiert wird. Das USMC bezieht sich wiederum auf das Human Performance, Training and Education (HPT&E) Program. In unserem Artikel Wie Special Operations Forces dem Kampf einen Schritt voraus sind haben wir diese neuen Methoden eingehend untersucht.
Im Kern basieren jedoch fast alle aktuellen westlichen SOF-Auswahlverfahren und Ausbildungen auf den Lehren des britischen SAS. Dieser bezieht sich auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Was im Zweiten Weltkrieg gut und nützlich war, muss also auch heute noch funktionieren, so die Annahme. Dies ist jedoch falsch, auch wenn NATO-Mitglieder wie Großbritannien, die Niederlande und Belgien von diesem SAS-/Commando-Gedanken kaum oder nicht abrücken wollen (auch wenn es durchaus positive Aspekte gibt). An dieser Stelle soll jedoch kein falscher Eindruck entstehen: Jede SOF-Generation war ein Produkt seiner Zeit und stellte damals die bestmögliche Option dar.
Einen noch viel größeren Schritt beschritt in der Vergangenheit jedoch das deutsche Kommando Spezialkräfte (KSK). Aus dem alten sehr selektiven Eignungs- und Auswahlverfahren (EAV) der 1990er Jahre wurde das Eignungsfeststellungsverfahren (EFV) der Jahrtausendwende und letztendlich das heutige neue moderne Potenzialfeststellungsverfahren (PFV). Es geht nun um ein weiterzuentwickelndes Potential, nicht mehr um eine reine Selektion. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Ansätze. Zitat:
„In den fast drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das KSK bei seinen zahlreichen Einsätzen ein großes Portfolio an Informationen und Erfahrungen gesammelt. Der Verband kann demnach präziser definieren, welches Potenzial ein Bewerber mitbringen muss. Im internationalen Vergleich gibt es mehrere Nationen, die ebenfalls bestrebt sind, ihre Auswahlverfahren anzupassen, da auch sie ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Die individuelle Testung ermöglicht es, den Bewerber oder die Bewerberin und die individuelle Leistungsfähigkeit genauer unter die Lupe zu nehmen.“
Im Kern sollen dabei weniger die physischen Aspekte in der Vordergrund treten. Im Umkehrschluss werden dabei mehr kognitive Elemente abgefragt. Der Kandidat für den Dienst in einer zukünftigen Spezialeinheit muss dabei besser und schneller lernen können, adaptiver sein und resilienter gegen äußere sowie innere Stress- und Störfaktoren sein. Dies ist eine hochkomplexe psychologische Testung unter enormen Stress und Anstrengung, das weit über das Marschieren und die Klimmzüge hinaus geht. Lies Special Forces Mindset: Wie du dich auf den ultimativen Test vorbereitest, um die dafür erforderliche Denkweise zu verstehen.
Das deutsche Konzept sieht nun zwei Phasen vor. Phase I besteht aus, Zitat:
„In der Phase 1 bestimmen eine Woche lang Sporttests und computergestützte psychologische Auswahlverfahren den Tagesablauf der Soldaten. Für die Offiziere gelten im Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit höhere Maßstäbe bei den Computertests als für Mannschaftssoldaten und Unteroffiziere. In der ersten Phase werden die körperliche Leistung und die Trainierbarkeit von benötigten Fähigkeiten überprüft. Außerdem müssen sich die Teilnehmenden mehreren psychologischen und kognitiven Testverfahren unterziehen. Diese werden durch den psychologischen Dienst des KSK umgesetzt. Nur jene Bewerber, die das Potenzial haben, später zu den Besten zu gehören, werden zur nächsten Phase zugelassen.“

Das frühere KSK-Zehn-Wochen-Programm wurde übrigens durch eine private Vorbereitung in Eigenverantwortung ersetzt. Die Teilnehmenden müssen damit bereits in der eigenen Vorbereitung ein hohes Maß an intrinsischer Motivation und Eigenständigkeit zeigen. Dies sind wesentliche Charakterstärken für spätere Kommandosoldaten. Das spart der Bundeswehr Zeit und Ressourcen, führt aber zwangsläufig nicht zu mehr geeigneten Kandidaten. Mehr über das detaillierte Auswahlverfahren der Special Forces mit Ex-SF-Mitgliedern erfährst du in einem anderen Artikel.
In der Phase II (u. a. „Höllenwoche“ mit hoher Marschleistung) des Potentialfestellungsverfahren werden, Zitat:
„…medizinische Daten erhoben, darunter der Blutzuckerspiegel, Puls und weitere spezifische Werte der Leistungsdiagnostik. Der Soldat wird mit einem Sender ausgestattet, um seine Geschwindigkeit und seinen Standort ständig verfolgen zu können. Ab sofort werden die medizinischen Daten rund um die Uhr überwacht, zur Sicherheit der Soldaten und zur Optimierung der Testung. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität der Bundeswehr in München. Wie in Phase 1 gilt die Bestenauswahl. Der Bewerber weiß zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens, ob seine gezeigten Leistungen ausreichen, um zu bestehen. Die Auswertung erfolgt erst am Ende der Woche und dann erfahren die Teilnehmende, ob sie zur Ausbildung zugelassen werden oder nicht.“

Nach aussagen der Bundeswehr schaffen aktuell ca. 1/ 3 der Bewerber Phase I und II. Ziel, Sinn und Zweck der neu strukturierten Auswahl der Kandidaten ist eben nicht die stumpfe Selektion, sondern die kritische Auswahl von Menschen, die das Potential zur weiteren Ausbildung und Weiterentwicklung haben. Diese müssen in ihrer späteren Dienstzeit schneller lernen, adaptiver mit schnell wechselnden Situationen umgehen können und resilienter gegen innere und äußere Störfaktoren sein. Würde er am Standpunkt seiner damaligen erfolgreichen Selektion stehenbleiben, wäre er dafür nicht geeignet. Deswegen spricht man von einem „Potential zur Weiterentwicklung“.
Konkret: War früher ein KSK-Soldat nach ca. sieben Jahren fertig ausgebildet, muss dies heute in ca. drei Jahren geschehen um Combat Ready für die NATO zu sein. Die Ausbildung ist dazu gestrafft und prozessoptimiert worden. Ebenso kann sich der Operator innerhalb kürzester Zeit in einer Hybriden Konfliktzone wiederfinden. Dazu kommen Propaganda, Agitation und Diversion sowie nachrichtendienstliche Operationen durch Feindkräfte und heimische Störergruppen, die Spezialkräfte ebenso verkraften müssen. Dies ist nicht einfach und erfordert ein Höchstmaß an intrinsischer Motivation, Stressresistenz und Allgemeinbildung sowie kognitiven Fähigkeiten. Dies hat nichts mehr mit Colonel Stirling und Paddy Maine im Wüstenkrieg zu tun oder der Jagd auf Osama Bin Laden. Es handelt sich seit dem Jahr 2014 (Krim-Krise) um eine komplett andere Liga der Kriegsführung, in dem militärische SOF eingesetzt werden müssen. Es ist an der Zeit, dies zu verstehen. Eine breitere Perspektive auf die neuen NATO-Missionen findest du unter Von hoch und heiß zu kalt und nass: neue Einsatzbereiche für NATO SOF.
Sehr ähnlich auch die Lage bei den westlichen Polizei-Spezialkräften wie GSG 9 und GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) oder EKO „Cobra“ in Österreich. Der Nachwuchs befindet sich in einer gesellschaftlichen Krise und muss bei bestandener Auswahl auf allen Ebenen sehr viel mehr leisten als vorher, bei maximaler Prozessoptimierung. Die Regenerationsphasen werden zukünftig noch viel kürzer Ausfallen und die externen Störfaktoren noch viel weiter zunehmen. Darüber hinaus müssen die fertig ausgebildeten SOF Einsatzkräfte insgesamt länger verfügbar sein (40+) bei gleichzeitig durchschnittlich weniger Stehzeit in der Spezialeinheit selber (ca. sieben bis zehn Jahre).
Die Zukunft der Ausbildung von SOFs: Virtual Reality und Human Performance Labs
Die Prozessoptimierung beginnt in der Spezialeinheit selber und baut auf den ausgewählten SOF-Kandidaten auf. Dieser muss für die neue Methodik und Systematik empfänglich und für Veränderungen offen sein.
Sonst funktioniert es nicht. Einer der Punkte ist die Einführung von immersiver Virtual Reality Trainingsanlagen. Als virtuelle Realität, (VR) wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet. Diese können Handlungsabläufe und Situationstraining über VR-Brillen in Raum und Zeit relativ realistisch darstellen, bei gleichzeitiger Schonung von Ressourcen und echter Zeit. Missionsprofile und taktische Lagen können hier vorgeübt und einstudiert werden. Dies geht sogar so weit, dass bereits bestehende Grundrisse von realen Gebäuden (Flughäfen, Banken, Botschaften, Schulen, Krankenhäuser, Konsulate usw.) schon jetzt in das digitale System eingespeist und dem Auszubildenden verfügbar gemacht werden können. Ebenso können in der Realität nur schwer darstellbare Situationen mit Kindern oder Tieren sowie Dunkelheit, Feuer und Lärm digital abgebildet werden. Dies ist beliebig oftmals wiederholbar auch in wechselnden Szenarien. Dazu kommt eine umfangreiche objektive und messbare Auswertung. Selbstverständlich ist durch eine VR-Trainingsanlage der scharfe Schuss nicht ersetzbar. Ebenso nicht das Üben am echten Objekt oder das Bewältigen von komplexen Medic-Lagen. Es beschleunigt jedoch die Vorausbildung massiv. Ebenso dürfen noch Fehler gemacht werden. Durch Fehler lernt man. Das Alter und die Generation der geschulten Einsatzkräfte spielt dabei interessanterweise eine Rolle. Operators die 20+ sind, finden sich wesentlich schneller und fehlerfreier zurecht, als die noch analoge SOF-Generation. Moderne VR-Trainigsanlagen wurden bereits bei der Polizei in Hessen (Deutschland) sowie auch beim deutschen KSK der Bundeswehr eingeführt. Ebenso bei weiteren internationalen Tier-1 SOF.
Ein weiteres Problem ist das fortgeschrittene Alter der GWOT-SOF-Generation und die kürzere Stehzeit von nachgenerierten SOF Operators. Ein Operator, der mit 40+ z. B. einen Fallschirmsprungunfall hat, wird sich davon altersbedingt vermutlich nie wieder richtig erholen können und steht somit der Spezialeinheit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Ein junger SOF Operator muss schon mit 20+ ein hochmodernes und begleitetes zielgerichtetes multifunktionales Sportpensum mit geplanten Regenerationsphasen kontrolliert durchlaufen, um auch noch mit 40+ zur Verfügung zu stehen. Durch die Einführung von Human Performance Labs bei der deutschen GSG 9 der Bundespolizei sowie dem KSK der Bundeswehr wird dieser Prozess optimal begleitet. Das Human Performance Lab vereint bei Polizei und Militär Kompetenzen aus Physiotherapie, Leistungsphysiologie und Trainingswissenschaft. Wurde Sport früher als stumpfe Leistung abgearbeitet mit hohen Verschleisswirkungen für den Körper, sieht man diesen Aspekt heute wissenschaftlich und unter dem Blickwinkel des ganzheitlichen Ansatzes.

SOF Operators müssen heute bis zur Pensionierung am besten gleichbleibende hohe Leistungen erbringen können, ohne zum medizinischen Problemfall zu werden. Dies wird durch ein ganzes Team an Sportlehrern und Sportwissenschaftlern sowie Physiotherapeuten gewährleistet. Es reicht nicht mehr nur noch hart gegen sich selber zu sein, sondern der clevere SOF versteht auch, wenn er Hilfe und Anleitung braucht. Das kann ein Human Performance Lab durchaus leisten. Human Performance Labs sind mittlerweile bei allen westlichen Tier-1 SOF eingeführt und etabliert und begleiten nun eine ganz SOF-Generation von Polizei und Militär in die Zukunft.
Fazit
Die Kombination aus veränderten Auswahlverfahren und neuer Ausbildungsmöglichkeiten sowie die wissenschaftliche Begleitung eines kognitiven starken SOF Operators, wird über Sieg oder Niederlage in der Zukunft entscheiden. Militärische westliche SOF müssen sich zwingend in einem Hybriden Umfeld behaupten können. Polizeiliche SOF müssen interne gesellschaftliche Krisen meistern und stehen immer mehr im Fokus von mächtigen Gegenspielern wie Narco-Kartelle und schwer bewaffneter Organisierter Kriminalität sowie Terrorismus. Verlieren ist dabei keine Option.