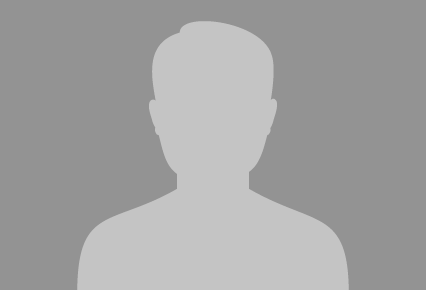Spezialkräfte sagen oft scherzend: „Mama says I’m special.“ Aber in ihrer Welt hat das Wort „special“ eine ganz eigene Bedeutung. Diese Operators werden nicht durch ihre Titel definiert – sie sind das Rückgrat von Elite-Streitkräften und stets bereit dazu, das Unmögliche in Angriff zu nehmen. Sie zählen zu den wenigen, die wirklich speziell sind: ausgebildet für Hochrisiko-Missionen unter Extrembedingungen, bei denen viel auf dem Spiel steht. In diesem Blogbeitrag taucht der Wiener Journalist Jürgen Hatzenbichler, Redakteur bei spartanat.com, in die einzigartige Welt der Special Forces ein. Jürgen betrachtet mit seinem Hintergrund in Philosophie und Geschichte die Ausbildung, die Ausstattung, das Mindset und das Engagement dieser Eliteeinheiten. Von Hochrisiko-Missionen bis zum unerbittlichen Willen zur Selbstverbesserung beleuchtet dieser Beitrag die Kernelemente, die Spezialkräfte auf dem modernen, dynamischen Gefechtsfeld auszeichnen.
In this blog post:
- Die einzigartige Welt der Spezialkräfte
- Spezialkräfte passen nicht in militärische Normen – und das ist ihre Stärke
- In der Welt der Elite Operators: von der GSG 9 bis zu den ukrainischen Special Forces
- Eine Operator-Kultur
- Das Training der Spezialkräfte: eine Welt der Extreme
- Spezialkräfte: ein scharfes, wertvolles Werkzeug
- Das weite Spektrum der Special-Forces-Einsätze
- Fazit: Wer wagt, gewinnt!
Autor: Jürgen Hatzenbichler
Die einzigartige Welt der Spezialkräfte
Alex war beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der deutschen Bundeswehr, er ist ein Offizier der frühen Stunde und noch immer aktiv. Auf unsere Frage „Was sind Spezialkräfte?“ antwortet er sehr direkt:
Alex served with the Kommando Spezialkräfte (KSK) of the Bundeswehr, Germany’s elite special forces. A seasoned officer from the early days, he remains active today. When we ask him what special forces are, his response is straightforward:
„Hochausgebildete, leistungsfähige und resiliente Kämpfer für besonders spezielle Lagen und Aufträge.“
Ulrich kommt wiederum aus der Welt der polizeilichen Spezialkräfte, genauer der Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9).
„Taktische operative Einheiten, welche aufgrund ihrer Ausbildung, Ausstattung und Einstellung in der Lage sind, komplexe, lebensbedrohliche Lagen, Bekämpfung von Terror und Schwerstkriminalität sowie Einsätze auszuführen, bei denen ein normaler Polizist überfordert ist“.
Gustavs Erklärung fällt breiter aus. Er ist ehemaliger deutscher Pionierunteroffizier der regulären Truppe, aber der Krieg hat ihn verändert. Fast seit Kriegsbeginn in der Ukraine war er dort im Einsatz und hat die Realität des Krieges direkt erlebt. Aktuell dient er in den Spezialkräften der Ukraine. Spezialkräfte sieht er als
„Eine Einheit, welche sich mit besonderen Aufgaben befasst, die so nicht durch die reguläre Truppe erfüllt werden können, oder reguläre Aufgaben mit alternativen Lösungsansätzen durchführt. Und hierzu besonders befähigt ist.“

Spezialkräfte passen nicht in militärische Normen – und das ist ihre Stärke
Für Nemo, Offizier der Deutschen Marine und Kampfschwimmer, besteht ein grundlegender Widerspruch zwischen konventionellen Militärstrukturen und dem Konzept der Spezialkräfte: „Militär ist Linie, Gleichheit, ein Versuch, Ordnung in das Chaos des Krieges zu bringen“, erklärt er. „Die Komplexität der Vorbereitung auch ohne den direkten militärischen Kontakt (Kampf) mit dem Gegner verlangt aufwändige Abläufe sowie Ordnung.“ Spezialkräfte operieren hingegen außerhalb dieser Grenzen, sie leben von Anpassbarkeit, Kreativität und asymmetrischem Denken.
Er nennt den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als ein frühes Beispiel dafür, wie starre Strukturen traditionelle Strategien dominieren, während agilere und unkonventionelle Taktiken zunehmend an Bedeutung gewinnen. Moderne Spezialkräfte entstanden aber erst später. Allen voran der britische Special Air Service (SAS) mit seinem ein Jahr älteren Bruder, dem Special Boat Service (SBS) sind die Vorreiter heutiger Special Operations und zeigen beispielhaft die Stärken unorthodoxer Kriegsführung, womit sie die Militärdoktrin auf den höchsten Ebenen verändert haben. Die Gründerväter Roger Courtney (SBS) sowie David Stirling (SAS) konnten beweisen, dass Erfolg in unvorhersehbaren Umgebungen verlangt, dass der Operator nicht nur Befehle befolgt, sondern darüber hinausdenkt.
In der Welt der Elite Operators: von der GSG 9 bis zu den ukrainischen Special Forces
Deutsche Spezialeinheiten haben lange im Schatten operiert – als disziplinierte Eliteeinheiten sind sie für Einsätze trainiert, die nur selten in die Schlagzeilen kommen. Über die Jahrzehnte hinweg haben diese Einheiten aber nicht nur Deutschlands Fähigkeiten im Kampf gegen den Terrorismus und im Bereich des schnellen Eingreifens verbessert, sondern werden auch weltweit bewundert sowie nachgeahmt. Heute reicht ihr Einfluss über die Grenzen Deutschlands hinaus bis etwa in die Ukraine, wo die moderne Kriegsführung sowohl Tradition als auch Innovation verlangt.
Deutschlands Weg hin zu modernen Spezialoperationen
In Deutschland begann die Evolution der Spezialoperationen mit Deutschlands ältester Spezialeinheit: den 1959 gegründeten Kampfschwimmern der Marine. Diese sollten sowohl im Wasser als auch an Land agieren und verkörperten den gleichen nonkonformistischen Geist, der für Spezialeinheiten weltweit charakteristisch ist. Ein Meilenstein war der Einsatz aus der Luft im Fallschirmsprung – auch ins Wasser. Dies wurde von den französischen Soldaten des „Commando Hubert“ übernommen, die mit an der Wiege dieser modernen deutschen Special Operation Forces (SOF) standen.
Am 1. April 1964 wurden die Kampfschwimmer zu einer selbstständigen Kompanie, sie unterstanden der Amphibischen Gruppe der deutschen Bundesmarine. Seit den 1970ern sind sie im Marinestützpunkt Nord in Eckernförde stationiert. Ende 1975 begann ein bahnbrechendes Austauschprogramm zwischen Kampfschwimmern und United States Navy SEALs, dem amerikanischen Gegenstück zu den Kampfschwimmern, um Ausrüstung, Einsatzverfahren und Ausbildung weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit hat nicht nur die Fähigkeiten der deutschen Spezialeinheiten erweitert, sondern unterstreicht auch die wichtige Erkenntnis: Special Operations leben von Unterschiedlichkeit, nicht von Konformität.
Die Entstehung und das Erbe der GSG 9
Auf die tragischen Ereignisse bei den Olympischen Spielen 1972 in München, als neun israelische Athleten während eines fehlgeschlagenen Geiselrettungsversuchs getötet wurden, folgte die Einsicht, dass Deutschland dringend eine spezialisierte Antiterroreinheit benötigt. Oberstleutnant Ulrich Wegener, damals Verbindungsoffizier beim Innenministerium, erhielt den Auftrag, diese aufzustellen. Im April 1973 war die GSG 9 dann einsatzbereit und musste ihre Fähigkeiten schon bald in der Praxis beweisen.
Ein entscheidender Moment für die Einheit war die Entführung des Lufthansa-Flugs 181 im Oktober 1977, bekannt als die „Landshut“-Entführung. Vier militante Palästinenser hatten sich des Flugzeugs bemächtigt und forderten die Freilassung inhaftierter Mitglieder der Roten Armee Fraktion. Nach fünf nervenzerreißenden Tagen stürmte schließlich ein GSG-9-Kommando das Flugzeug in Mogadischu, Somalia, und befreite alle 91 Geiseln ohne Verlust von Leben auf Seiten der Passagiere oder des Rettungsteams. Dieser Einsatz demonstrierte nicht nur die Effizienz der GSG 9, sondern festigte auch Wegeners guten Ruf und brachte ihm den Beinamen „Held von Mogadischu“ ein.
Was macht eine gute Spezialeinsatzkraft der GSG 9 aus? Der GSG-9-Beamte Ulrich betont die Bedeutung von Commitment: „Der Wille, ein Operator zu sein und dies leben zu wollen, sich täglich den Herausforderungen zu stellen und über seine mentalen und physischen Grenzen gehen zu wollen und zu können.“ Er glaubt, dass Operator zu sein nicht nur eine Rolle ist, sondern eine persönliche Berufung, die verlangt, dass man sein gesamtes Leben darauf einstellt, die Anforderungen zu bewältigen.
MELDE DICH FÜR WEITERE INFOS WIE DIESE AN
Trage deine E-Mail-Adresse ein und bleibe auf dem Laufenden über Taktische Bekleidung und andere relevante Themen.
Du meldest Dich für unseren Newsletter an und Du kannst Dich jederzeit abmelden. Lese mehr in unserer Datenschutzerklärung.
Die duale Natur der Spezialeinheiten: Polizei und Militär
Die GSG 9 ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Spezialeinheiten sowohl in den polizeilichen als auch in den militärischen Bereich erstrecken können. Sie wurde nicht aus einer bestehenden militärischen Spezialtruppe, sondern aus dem „paramilitärischen“ Bundesgrenzschutz (BGS) gegründet. Heute gibt es keinen BGS mehr, die GSG 9 gehört zur Bundespolizei. Ulrich von der GSG 9 erklärt dazu: „Polizeieinheiten waren schon immer militärisch strukturiert.“
Während das Militär sich auf Gefechtssituationen fokussiert, sind polizeiliche Spezialeinheiten wie die GSG 9 gegen zivile Bedrohungen da. Zu ihren Aufgaben zählen Terrorismusbekämpfung, Geiselrettung und spezielle Polizeiaufgaben – hier wird deutlich, wie Spezialkräfte je nach Bedarf nahtlos zwischen militärischen und polizeilichen Rollen wechseln können.

Evolution der deutschen Spezialeinheiten: das KSK
Zwei Jahrzehnte später erweiterte sich der Fokus für die Fähigkeiten von Eliteeinheiten von der Terrorismusbekämpfung zu weltweiten militärischen Einsätzen. Die Gründung des Kommando Spezialkräfte (KSK) im Jahr 1996 ist aus dem Wunsch entstanden, eine militärische Krisenreaktionseinheit zu entwickeln, die für komplexe internationale Missionen bereit ist. Anstoß zur Gründung des KSK gaben insbesondere auch die logistischen und operativen Herausforderungen rund um die Ruanda-Krise, in deren Zusammenhang Deutschland seine Staatsbürger möglichst effizient evakuieren musste.
Das KSK wurde nach dem Vorbild des britischen SAS modelliert und war von Anfang an für Personen mit Gefechtserfahrung sowie taktischem Verständnis sehr attraktiv. Als eines seiner ersten Mitglieder erzählt Alex hierzu: „Warum das Rad neu erfinden, wenn es schon welche gibt, die es einem exzellent vormachen?“ Die Aufgaben des KSK umfassen Aufklärung, Überwachung und die Rettung deutscher Staatsbürger aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten. Mit der Zeit kamen auch verschiedenste Hochrisiko-Missionen und Operationen aus dem Bereich der unkonventionellen Kriegsführung dazu. Allerdings kam die Einheit auch international für ihre elitäre Kultur und einen ideologischen Drift nach rechts in die Kritik. Daraufhin wurden Reformen implementiert, um die Kontrolle und die demokratische Kultur im KSK zu stärken.
Ukrainische Special Forces: ein Mix aus Tradition und Innovation
Kaum irgendwo zeigt sich der Geist der Anpassung deutlicher als in der Ukraine, wo aus dem Konflikt eine neue Generation von Special Operators entstanden ist. Einer von ihnen ist der vormalige Unteroffizier der Bundeswehr Gustav, der in der ukrainischen International Legion dient. „Es ist sehr durchwachsen“, erklärt Gustav. „Das war ein Mix aus US MARSOC, Green Bereits, US Army Ranger und lettische SUV, Estsof und finnischen Utti Jaeger, um die größten Anteile zu benennen.“
Ukrainische Spezialeinheiten setzen einen vielschichtigen Mix von Doktrinen der verbündeten NATO-Staaten ein, um auf ausdrücklich lokale Probleme zu reagieren. Drohnen haben beispielsweise eine zentrale Bedeutung erlangt. So wird der Begriff „Drone Operator“ heute oft für die Piloten der UAVs verwendet – eine Evolution dieser Bezeichnung, die stellvertretend für die Entwicklungen auf dem Gefechtsfeld steht.
Interessanterweise bleibt die Bezeichnung „Operator“ in der Ukraine teils für Personen mit westlichem Special-Forces-Hintergrund reserviert und trägt somit ein gewisses informelles Ansehen. Der Krieg hat diese Identität demokratisiert: Fronterfahrung und nicht Abstammung bestimmen den Wert eines Kämpfers.
Während der Krieg weitergeführt wird, zeigen die ukrainischen Spezialkräfte zunehmend, wie die Zukunft des asymmetrischen Krieges aussieht: schlank, technisiert und stark dezentralisiert. Ihre Anpassbarkeit kann als Lektion für alle Spezialeinheiten gelten – Friedenszeiten sind keine Entschuldigung für Selbstgefälligkeit. Die Vorbereitung ist nie abgeschlossen.
Die Zukunft neu denken
Deutschlands Spezialeinheiten – ob GSG 9 oder KSK – und ihre Gegenparts in der Ukraine stehen vor einer Welt, die nicht mehr nach konventionellen Regeln spielt. Überwachung, Drohnen, Cybertechnologien und Künstliche Intelligenz schreiben die operativen Handbücher neu. Heutige Eliteeinheiten müssen nicht nur härter, sondern auch smarter trainieren, ständig zum Nachjustieren bereit.
Bei all diesen Veränderungen bleibt aber eines gleich: das, was es bedeutet, ein Operator zu sein. Dafür maßgeblich ist weder die Uniform noch der Patch noch die Art der Mission, sondern das Mindset. Sowohl bei der Erstürmung einer entführten Passagiermaschine in Somalia als auch bei einem Aufklärungsflug mit der Drohne über der Ostukraine definiert genau dieses Mindset weltweit die Elite der Kampfeinheiten.
Eine Operator-Kultur
Was benötigt man, um den Spezialkräften beizutreten? Wir haben Kampfschwimmer Nemo gefragt. Nach kurzem Nachdenken antwortet er: „Es braucht Menschen, die bereitwillig und freiwillig – Tauchen in der Deutschen Marine ist immer freiwillig – mit hoher Eigenmotivation sich dem Dienst um des Dienens willen stellen.“ Man brauche „Charakterköpfe mit Lösungsbegabung“. Diese seien „‚brilliant in the basics‘. Dadurch können sie in den Teams oder in der Führung eingesetzt werden.“
Veteranen beschreiben dieses Mindset eher als eine Reihe von Fähigkeiten.
Dieses Mindset spiegelt auch die Sichtweise, die Ulrich von der GSG 9 bereits ansprach. GSG 9 und KSK verlangen mehr als nur physische Spitzenleistungen – auch psychologische Resilienz und die Fähigkeit, selbst mit unvollständigen Informationen und unter extremem Druck selbständig zu handeln, sind entscheidend.
Deshalb ist für die Vorbereitung auf Special-Forces-Einsätze nicht nur die körperliche Ausdauer von Bedeutung, sondern auch das richtige Mindset. Wie man dieses entwickelt, erkunden wir in unserem Blogbeitrag Special Forces Mindset: How to Prepare, der untersucht, warum mentale Konditionierung bei der Vorbereitung von Eliteeinsätzen genauso wichtig ist wie körperliches Training.

Das Training der Spezialkräfte: eine Welt der Extreme
Spezialkräfte-Operators sind dafür trainiert, in den härtesten vorstellbaren Bedingungen – sowohl physisch als auch mental – ihre Arbeit verrichten zu können. Ihre Ausbildung umfasst das gesamte Spektrum möglicher Umgebungen: arktische Kälte bis –30 °C, Wüstenhitze bis über 40 °C und feuchte Dschungel mit mehr als 90 % Luftfeuchtigkeit. Operators müssen in all diesen Konditionen leistungsfähig sein. Ausdauer ist ein weiterer Schlüsselfaktor – 5000-Meter-Läufe in unter 20 Minuten, Seeschwimmen bis 30 Kilometer und das Tragen von mehr als 60 kg Gepäck gehören zu den Grundvoraussetzungen.
Eliteeinheiten durchlaufen auch ein besonders anspruchsvolles Luftlandetraining. Techniken wie HALO (High Altitude, Low Opening) und HAHO (High Altitude, High Opening) erfordern nicht nur Mut, sondern auch unglaubliche Präzision und Ausdauer. Bei HALO-Sprüngen springen die Operators aus über 3 km Höhe und öffnen ihren Fallschirm erst kurz vor dem Boden – ideal, um bei Stealth-Missionen hinter feindlichen Linien unentdeckt zu bleiben. Bei HAHO-Sprüngen wird der Fallschirm wiederum schon kurz nach dem Sprung geöffnet, um danach fast lautlos über weite Strecken zu gleiten. Für beide Techniken sind eine Gewöhnung an große Höhen sowie außergewöhnliche Selbstkontrolle unter Druck unverzichtbar.
In unserem Blogpost Special Operations Forces: Future Training haben wir uns genauer angeschaut, wie sich Eliteeinheiten auf die große Vielfalt der Herausforderungen vorbereiten und wie sich die Trainingsmethoden weiterentwickeln.
Physische Kondition ist aber nur eine Seite der Medaille. Mentale Resilienz ist genauso wichtig. Special Forces Operators sind dafür trainiert, unter enormem Stress zu handeln – eine Waffe in unter einer Sekunde zu ziehen und abzufeuern, blitzschnell zwischen Freund und Feind zu unterscheiden sowie komplexe Aufgaben unter Mangel von Sauerstoff und oft tagelangem Schlafmangel auszuführen. Die Fähigkeit, unter Beschuss ruhig zu bleiben, Informationen schnell zu verarbeiten und in Sekundenbruchteilen über Leben und Tod zu entscheiden, macht den Unterschied.
Dieses Maß an Bereitschaft lässt sich nicht über Nacht erreichen. Es wird durch harte Auswahl sowie Vorbereitung kultiviert. Diese betrachten wir genauer in diesen Blogbeiträgen: Special Forces Selection Process: How to Get In.

Missionen aus dem echten Leben geben uns einen Einblick, auf was die Operators im Training vorbereitet werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Navy SEAL Team 6 Operation, die zum Ausschalten von Osama bin Laden geführt hat – eine Mission, für die HALO-Fähigkeit, Tarnung, blitzschnelles Entscheiden und Präzision unter Druck erforderlich waren. Auch die Operation Entebbe, bei der israelische Spezialeinheiten in Uganda Geiseln befreiten, demonstriert die schnelle Planung und makellose Durchführung, die solche Eliteeinheiten auszeichnet.
Diese Geschichten – sowie das Training dahinter – zeigen, wieso Spezialkräfte zu den fähigsten, zuverlässigsten und resilientesten Profis in modernen Militäroperationen zählen.
Spezialkräfte: ein scharfes, wertvolles Werkzeug
Letztlich ist jeder Operator ein „Werkzeug“ im Dienst der nationalen Sicherheit, an der Speerspitze eingesetzt. Er muss in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, die erhebliche Folgen haben können. Das Training für einen einzelnen Operator kann mehr als 1,5 Mio. Euro kosten, bis er nach drei Jahren intensiver Ausbildung einsatzbereit ist. Damit sind Spezialkräfte nicht nur Elitesoldaten, sondern strategische Instrumente für die Militär- und Polizeiführung.
Wenn sie in den Einsatz gehen, arbeiten Spezialkräfte am besten in kleinen Teams unter den stressreichen Bedingungen. Alex vom KSK formuliert es so:
„Wir sind Olympioniken, die es nicht gäbe, wenn dahinter nicht ein starker Sportverband mit vielen Profi- und Breitensportlern stünde.“
Er betrachtet Spezialkräfte nicht als „besser“ als reguläre Einheiten, sondern als die Spitze einer Pyramide, oft als die scharfe Elite-Kante einer größeren Organisation.

Das weite Spektrum der Special-Forces-Einsätze
Spezialkräfte sind dafür trainiert, vielseitig zu sein und vielfältige Rollen einnehmen zu können – all dies oft in Situationen, in denen herkömmliche Streitkräfte nicht eingreifen können. Ihre Fertigkeiten umfassen ein breites Feld von kritischen Operationen:
- Direct Action: direkter Kampfeinsatz, der die Gewalt zum Gegner bringt
- Special Reconnaissance: Gewinnen von Informationen als Spezialaufklärung für die operative Ebene
- Military Assistance: Durchführen von Ausbildungsmissionen im Ausland
- Close Protection: Anbieten von Personenschutz
- Hostage Rescue and Recovery: Befreien von Geiseln und ihre sichere Rettung
- Counterterrorism: Kampf gegen Terrorismus
- Unconventional Warfare: Guerillakrieg sowie die Ausbildung und Unterstützung von Aufständischen
- Covert Operations: Durchführen von verdeckten Operationen

Fazit: Wer wagt, gewinnt!
Spezialkräfte unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Militäreinheiten. Ihre einzigartigen Fertigkeiten und ihre Elite-Ausbildung macht sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für kritische Operationen. Das Motto des britischen SAS lautet: „Who dares, wins.“ Spezialkräfte übernehmen die gefährlichsten und wichtigsten Missionen, oft unter höchster Geheimhaltungsstufe. Sie sind immer bereit, auch wenn andere es noch nicht sind, und können dort agieren, wo reguläre Einheiten das nicht können. Ihre Arbeit ist zermürbend, oft unter Verschluss und stets an der Frontlinie der nationalen Sicherheit.
Spezialeinheiten werden nicht nur in Trainingscamps und auf weit entfernten Gefechtsfeldern geschmiedet – sie werden auch von einer Philosophie geformt, die über Uniform und Rang hinausgeht. Hierbei geht es um Präzision, Bescheidenheit und Resilienz gegenüber dem Unvorhersehbaren.